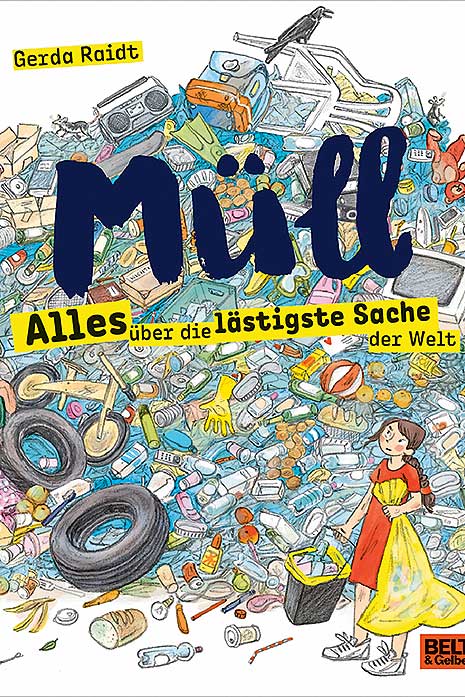Von May-Britt Winkler
Julian – Martas Sohn – schmunzelt über die Aussage seiner Mutter. Humor hat ihm und seiner Familie schon oft geholfen. Julian ist 13 Jahre alt, ein guter Schüler der 8. Klasse der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt, eine Sportskanone, ein Bruder, ein Hundebesitzer, ein Minecraft-Fan, ein Träumer von einer großen Zukunft und ein Junge mit nur einem Bein.
„Es begann damit, dass mir ständig mein rechtes Bein wehtat“, beginnt Julian seine Geschichte zu erzählen. Die Schmerzen kamen und gingen, bis er irgendwann kaum noch laufen konnte. Der Orthopäde diagnostizierte mit einem Blick von außen Wachstumsbeschwerden, und auch auf einem Röntgenbild konnte er nichts erkennen. Der Penetranz seiner Mutter, einer Krankenschwester, die auf ein MRT (eine Magnetresonanztomographie) bestand, ist es zuzuschreiben, dass Julian heute noch lebt. Und der Fernsehserie „Club der roten Bänder“, die sich die Familie nur einige Wochen zuvor angesehen hatte. „In mir machte sich sofort ein ungutes Gefühl breit“, erinnert sich Marta. Die Geschichten um Leo, einen jungen Krebspatienten, und seine Freunde im Krankenhaus, haben Julian also vermutlich das Leben gerettet. „Es war ein bisschen, als hätten sich diese Erzählungen auf unser eigenes Leben gelegt“, sagt Julians Vater Jürgen Schwarz rückblickend.
Der Arzt, der das MRT schließlich vorgenommen hat, entdeckte eine Wucherung im Knochen und schlug sofort Alarm. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. In der Uniklinik Frankfurt wurde eine Biopsie gemacht. Der Befund: Osteosarkom. „Das ist ein hochaggressiver Knochenkrebs“, erklärt Jürgen und denkt an die ersten Momente zurück, als er die Kinder-Onkologie des Krankenhauses betrat: „Das war ein Schock. Da waren Kinder mit Schläuchen im Körper, mit Infusionen und ohne Haare.“ Julian war nun einer von ihnen.
Es folgten Chemotherapien und mehrere Operationen, denn der Krebs hatte bereits gestreut und die Lunge angegriffen. Der wohl einschneidendste Eingriff war die Amputation seines rechten Beines. Das alles in einer Zeit, als die Corona-Pandemie die Welt dominierte und in Kliniken Besuchsverbote herrschten. Niemand außer seiner Mutter, die Tag und Nacht bei Julian war, durfte zu ihm. Der Vater kam dennoch jeden Abend an die Pforte, um irgendetwas vorbeizubringen und nicht ganz tatenlos zu sein. „Ich hatte so schlimme Schmerzen“, erinnert sich Julian. „Ich hatte sowieso für gar nichts Kraft. Nicht einmal für Besuche.“
„Es war eine ganz schwierige Zeit“, ergänzt sein Vater. Mit großem Leid für alle Familienmitglieder: für Julian mit seinen Beschwerden und der ständigen Übelkeit durch die Chemotherapie, für die Eltern mit ihren Ängsten und auch für die beiden Geschwister, die ganz plötzlich auf sich gestellt waren und selbstständig sein mussten: Erwachsen über Nacht. Anderthalb Jahre lang – von kurzen Unterbrechungen abgesehen – war Julian ans Krankenhausbett gefesselt. Seine Schwester Sofia war damals 13 Jahre alt und plötzlich allein verantwortlich für einen Haushalt, allein mit ihren Sorgen – überhaupt fast immer allein.
Doch heute sind sie wieder vereint. Prioritäten haben sich verschoben, und Dankbarkeit hat sich breitgemacht. Es muss nichts Großartiges passieren. Großartig ist schon, wenn nichts Schlimmes passiert. Dennoch bleibt da immer ein Funken Angst. „Manchmal mache ich mir schon Gedanken, dass der Krebs wiederkommt“, sagt Julian. Aber das haben alle gelernt: Sie leben im Hier und Jetzt; mit dem, was eben geht und zur Verfügung steht.
 Hat man nur ein Bein, dann lernt man, es zu nutzen. Und so hat Julian irgendwann angefangen, wieder Sport zu treiben. Blickt er zurück auf die Zeit, in der er noch beide Beine hatte – auf die Zeit vor seiner Amputation – dann wäre er gern nochmal richtig schnell gerannt. „Aber ich hatte solche Schmerzen, das ging leider nicht mehr.“ Jetzt holt er es nach, treibt Leichtathletik, spielt ab und an Hockey, schwimmt gern und fährt neuerdings Ski. Während manch anderer sich kaum zweibeinig auf den Brettern halten kann, rast Julian auf einem Bein die Pisten herunter.
Hat man nur ein Bein, dann lernt man, es zu nutzen. Und so hat Julian irgendwann angefangen, wieder Sport zu treiben. Blickt er zurück auf die Zeit, in der er noch beide Beine hatte – auf die Zeit vor seiner Amputation – dann wäre er gern nochmal richtig schnell gerannt. „Aber ich hatte solche Schmerzen, das ging leider nicht mehr.“ Jetzt holt er es nach, treibt Leichtathletik, spielt ab und an Hockey, schwimmt gern und fährt neuerdings Ski. Während manch anderer sich kaum zweibeinig auf den Brettern halten kann, rast Julian auf einem Bein die Pisten herunter.
Auch Sitzvolleyball hat er schon ausprobiert. Aber Sitzen ist gar nicht so sein Ding. Es ist auch nicht nötig, denn drei verschiedene Prothesen stehen für ihn zum Laufen bereit. Seine Lieblingsstück ist die Sportprothese. „Dennoch ist das Laufen und Rennen für ihn mehrfach anstrengend“, berichtet Mama Marta ein klein bisschen besorgt.
 Theoretisch hat Julian auch ein Paar Krücken, selbst wenn er die ungern nutzt. „Man hört immer, wenn Julian aufgestanden ist“, erzählt Marta. „Er hüpft dann im Obergeschoss auf einem Bein ins Bad, sodass das ganze Haus bebt.“ Da ist er wieder: der Humor, den alle haben und wohl auch notgedrungen brauchen. Und so schlägt die Familie an Halloween oder Fasching eben vor, dass Julian doch als Pirat gehen könnte: mit Holzbein als Prothese.
Theoretisch hat Julian auch ein Paar Krücken, selbst wenn er die ungern nutzt. „Man hört immer, wenn Julian aufgestanden ist“, erzählt Marta. „Er hüpft dann im Obergeschoss auf einem Bein ins Bad, sodass das ganze Haus bebt.“ Da ist er wieder: der Humor, den alle haben und wohl auch notgedrungen brauchen. Und so schlägt die Familie an Halloween oder Fasching eben vor, dass Julian doch als Pirat gehen könnte: mit Holzbein als Prothese.
Julian lacht darüber, wie jeder Junge seines Alters es tun würde. Dennoch wirkt er viel reifer als die meisten 13-Jährigen. Auch für ihn sind andere Dinge im Leben wichtiger geworden: „Es hat wohl uns alle verwundert, dass ich inzwischen ein richtig guter Schüler mit Einsen und Zweien bin. Vorher habe ich viel mehr Dreier und Vierer geschrieben. Ich gehe inzwischen wirklich gern in die Schule.“
Deutsch, Englisch und Geschichte sind seine Lieblingsfächer, und er musste trotz seiner langen Krankenzeit nicht einmal das Schuljahr wiederholen. Ein Beispiel dafür, dass für manchen die Pandemie mit dem Home-Schooling auch von Vorteil war. Hatte die Krankheit denn überhaupt auch irgendetwas Gutes? „Ja“, sagt Julians Mutter. „Im Schicksal sind die Menschen wie nackt; ohne Fassaden. In dieser Zeit haben wir schöne Menschen kennengelernt.“
 Zudem gibt es seit der Entlassung aus dem Krankenhaus einen guten Grund, gesund zu bleiben. Der ist etwa 60 Zentimeter groß, hat goldbraunes Fell und heißt Percy. Ein Hund der Rasse „Magyar Vizsla“ und leider so stürmisch, dass er Julian locker den Boden unter dem Fuß wegreißen kann. „Wir versuchen aber, ihn zu erziehen“, gesteht er augenzwinkernd. Die Betonung liegt auf „versuchen“. Macht nichts: Percys Anwesenheit allein ist schon Balsam für die Seele; der von Julian ebenso wie der von Sofia. Alle lieben ihn.
Zudem gibt es seit der Entlassung aus dem Krankenhaus einen guten Grund, gesund zu bleiben. Der ist etwa 60 Zentimeter groß, hat goldbraunes Fell und heißt Percy. Ein Hund der Rasse „Magyar Vizsla“ und leider so stürmisch, dass er Julian locker den Boden unter dem Fuß wegreißen kann. „Wir versuchen aber, ihn zu erziehen“, gesteht er augenzwinkernd. Die Betonung liegt auf „versuchen“. Macht nichts: Percys Anwesenheit allein ist schon Balsam für die Seele; der von Julian ebenso wie der von Sofia. Alle lieben ihn.
 Percy bedeutet Glück, und das steht jetzt ganz oben auf der Liste von Familie Schwarz-Diaz-Manresa. Es schien ja auch lange Zeit abwesend. Dabei ist Glück ohnehin relativ, denn Glück war es schließlich auch, dass Julian überlebt hat. Er ist froh, das Schlimmste überstanden zu haben: „Ich habe es wirklich vermisst, gesund zu sein.“ Kleine Dinge sind ihm heute wichtig, was aber nicht heißt, dass es in Julians Leben keine großen Pläne gibt.
Percy bedeutet Glück, und das steht jetzt ganz oben auf der Liste von Familie Schwarz-Diaz-Manresa. Es schien ja auch lange Zeit abwesend. Dabei ist Glück ohnehin relativ, denn Glück war es schließlich auch, dass Julian überlebt hat. Er ist froh, das Schlimmste überstanden zu haben: „Ich habe es wirklich vermisst, gesund zu sein.“ Kleine Dinge sind ihm heute wichtig, was aber nicht heißt, dass es in Julians Leben keine großen Pläne gibt.
„Das wäre schon ein Traum, mal in die Politik zu gehen und im Bundestag zu sitzen. Auch Profi-Skifahrer werden, wäre was. Oder aber Journalist; das wäre auch toll“, begeistert sich Julian. Tja, wer weiß: Vielleicht schreibt er ja irgendwann mal diese Rubrik.