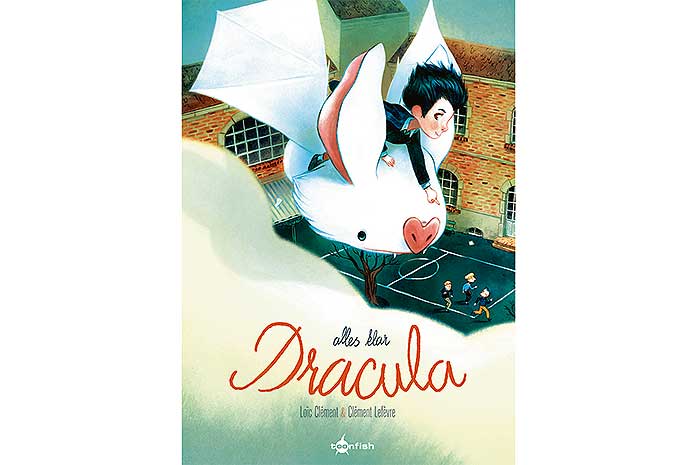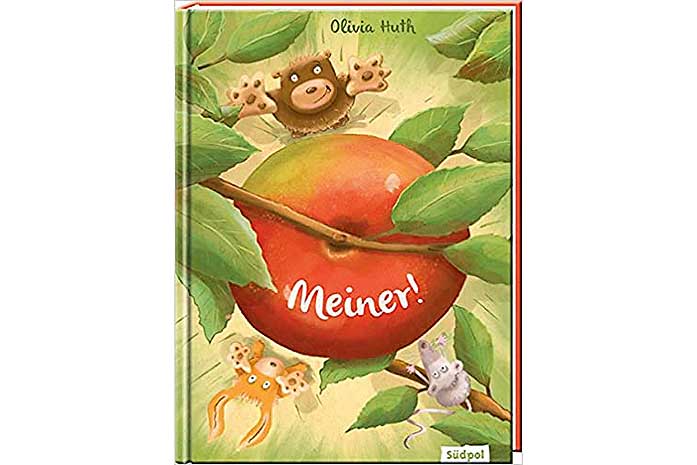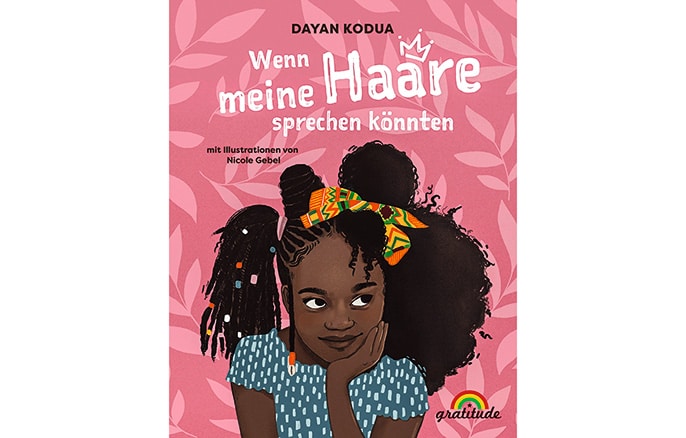Wie fühlen sich die Familien, deren Baby viel früher als geplant ins Leben purzelt? Katarina Eglin ist auf diesem Gebiet Fachfrau in doppelter Hinsicht. Ihr Sohn Paul kam vor neun Jahren nach 24+3 Schwangerschaftswochen zur Welt, wog gerade mal 595 Gramm und gehörte damit zu dem einen Prozent der extrem gefährdeten Frühchen. Heute engagiert sich Katarina Eglin im Bundesverband „Das frühgeborene Kind e. V.“, organisiert Treffen von Frühchen-Eltern im Raum Darmstadt und weiß um die Sorgen und Probleme betroffener Familien.
Ständige Ungewissheit
Ich hatte mich damals mit wochenlangem Liegen in die 24. Woche reingezittert. Nach dem Kaiserschnitt wurde Paul – in Frischhaltefolie gewickelt, damit er nicht auskühlt – sofort aus dem OP in die Intensivstation getragen und dort erstversorgt. Ich bekam erst mal nur ein Polaroid-Foto von ihm“, erzählt sie. Wie ein kleines nacktes Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist – mit diesem Vergleich beschreiben viele Eltern treffend den ersten Eindruck von ihrem Frühchen. Und oft dauert es eine Zeitlang, bis man einen Kontakt zu diesem kleinen Wesen findet, schließlich sei man noch gar nicht auf Mama-Sein programmiert, so Katarina Eglin. „Ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, Paul anzufassen; er sah so zerbrechlich aus, und ich wollte doch keine Bakterien auf ihn übertragen.“ Die größte Angst ist, dass das Baby sterben könnte. „Wir waren jedes Mal, wenn wir morgens an der Stationstür geklingelt haben, voller Furcht, dass uns schlechte Nachrichten erwarten.“
Familie in Umbruchsituation
Auch zu Hause wirbelt die frühe Ankunft des Babys einiges durcheinander, vor allem wenn ein größeres Geschwister da ist. Die häufigen Besuche der Eltern in der Klinik verstärken bei ihm das Gefühl, dass Mama und Papa nur noch das Baby lieb haben. Der Spagat zwischen Krankenhaus und Zuhause ist für alle Beteiligten sehr aufreibend. Katarina Eglin empfiehlt daher: „Holen Sie sich Hilfe! Bitten Sie Verwandte, Freunde und Nachbarn ganz konkret darum, mal Essen zu kochen, einkaufen zu gehen, mit dem großen Geschwister zu spielen.“ Das schafft Entlastung, und die ist wichtig. Nicht nur um selbst wieder zu Kräften zu kommen, sondern um möglichst viel Zeit mit dem Frühchen verbringen zu können. Denn: Es ist ganz entscheidend, früh einen Draht zum Baby zu finden. „Das Bindungszeit-Fenster ist knapp und sollte genutzt werden. Frühes und häufiges Känguruhen baut den Eltern-Kind-Kontakt auf und kann zugleich Babys in kritischem Zustand stabilisieren, weil sie den beruhigenden Herzschlag der Eltern hören“, so Katarina Eglin.
Und wie geht die Geschichte der Familie Eglin weiter?
„Pauls Hauptproblem war die Atmung. Nach sieben Monaten in der Klinik wurde er als ‚Stations-Opa‘ schließlich entlassen, mit einer kleinen Intensivstation (Sauerstoffbrille, Magensonde) im Gepäck. Zu Hause fing dann endlich das Familienleben an.“ Der schwierige Start und die atypische Entwicklungsumgebung in den ersten Monaten haben ihre Spuren bei Paul hinterlassen. Heute besucht Paul eine Förderschule, kann laufen und einige Worte sprechen. „Und er hat Spaß, ist ein fröhlicher, frecher Junge. Das ist für uns das Wichtigste. In den ersten Wochen mit ihm hatten wir uns öfters die Frage gestellt: Tun wir das Richtige, wenn wir ihn in ein Leben mit Beeinträchtigung entlassen? Heute können wir diese Frage aus vollem Herzen bejahen“, so Katarina Eglin.
Ein Beitrag von Monika Klingemann.