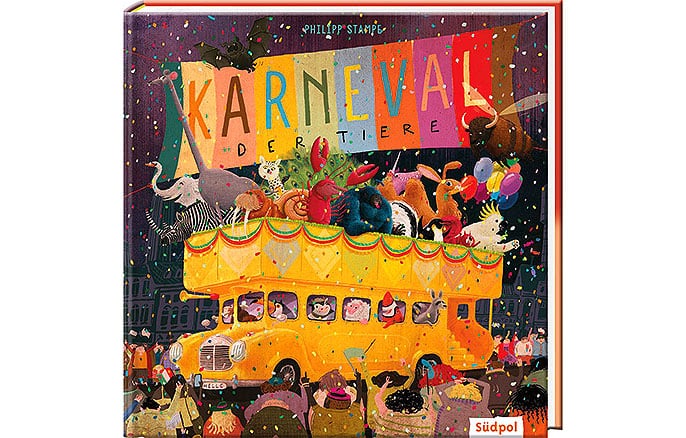Ein Beitrag von Monika Klingemann
Kürzlich auf dem Spielplatz: Das Mädchen kann sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht vom Sandkasten lösen, die Mutter ist entnervt und will endlich los: „Wenn du nicht kommst, geht die Mama allein nach Hause.“ Pause. „Tschüss, die Mama geht jetzt weg!“
Eine Situation, die wir alle kennen. Solche „Wenn … dann“-Sätze kommen vielen von uns immer mal wieder über die Lippen. So versuchen wir, das Kind von der Dringlichkeit unserer Aufforderung zu überzeugen.
Wie könnte die Szene weitergehen?
Kurzfristig mag die gravierende Androhung sogar Erfolg haben. Das Kind denkt sich: Bevor ich allein auf dem fremden Spielplatz bleibe, komme ich mal lieber mit. Doch vielleicht hat es auch gelernt, dass den Worten keine Taten folgen, und spielt gleichgültig weiter. Im harmlosen Fall ernten wir also nur einen müden Augenaufschlag, wenn wir mit Drohungen um uns werfen, die offensichtlich doch nicht umgesetzt werden.
Also besser der Ankündigung doch mal Konsequenzen folgen lassen und um die Ecke verschwinden, damit „das Kind endlich mal sieht, was passiert, wenn es nicht hört“? Dann können im schlimmsten Fall Ängste entstehen. Das Kind verliert sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit seiner Eltern: Mama lässt mich allein zurück!
Strafen durch die Hintertür
Klar, die schwarze Pädagogik mit drakonischen Strafen oder ihrer Androhung haben wir längst hinter uns gelassen. Und klar, kein Kind darf geschlagen werden und auch der „kleine Klaps auf den Po, der noch keinem geschadet hat“ ist tabu.
Mit Demütigungen, Schlecht-Machen und Isolieren sieht es da manchmal schon anders aus. „Mann, bist du denn zu dumm, das zu verstehen?“, „Ab auf dein Zimmer – und lass dich in der nächsten Stunde nicht mehr blicken!“
Mit Drohen, Locken und Erpressen versuchen wir uns doch gerne mal, wenn uns sonst die Werkzeuge ausgehen. Die wenigsten Eltern sprechen heute davon, dass sie ihr Kind bestrafen, doch sind Konsequenzen oder Sanktionen nicht auch nur Strafen durch die Hintertür? Das alte Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche wirkt oft noch fort. „Wenn du weiter deinen Bruder ärgerst, gibt es heute Abend kein Fernsehen!“ Oder sogar: „Wenn du nicht endlich deine Hausaufgaben machst, fahren wir in den Ferien nicht in den Urlaub!“
Gehorchen zum Selbstzweck?
Doch Autorität, die nur auf Macht basiert, ist nicht von Dauer. Sie mag für den Moment wirken. Aber was für eine Lehre kann ein Kind daraus ziehen: Ich muss schnell ganz stark werden, damit ich endlich die Macht habe, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und über die anderen zu bestimmen.
Und wollen wir wirklich gehorsame, autoritätshörige Kinder? Wollen wir, dass Kinder etwas tun, nur weil wir es sagen? Dass sie gehorchen, um nicht bestraft zu werden? Sicher nicht.
Und wollen wir wirklich gehorsame, autoritätshörige Kinder? Wollen wir, dass Kinder etwas tun, nur weil wir es sagen? Dass sie gehorchen, um nicht bestraft zu werden? Sicher nicht.

Belohnen als Machtinstrument
Aber wie ist es mit Belohnungen? Von ihnen profitiert das Kind doch ganz direkt, oder? Nein, denn auch Belohnungen sind letztlich nichts anderes als Manipulations- und Machtinstrumente für die Kontrollierenden, also die Eltern. Denn wir wollen ja mithilfe einer kleinen Erpressung unseren Willen durchsetzen.
Dazu kommt: Das System des Belohnens ist kompliziert und nicht immer konsequent durchzuhalten. Irgendwann wirken in Aussicht gestellte Vergünstigungen sowieso nicht mehr, weil die Heranwachsenden sich die Süßigkeit, das Video, den Comic bequem selbst besorgen können. Spätestens dann gehen uns die Mittel aus …
Wird Wohlverhalten durch Belohnungen „erkauft“, gibt es Freundlichkeit, Mithilfe und Kooperation bald nur noch, wenn sie belohnt werden. Und auch Belohnungen beziehungsweise ihr Ausbleiben können Angst-, Schuld- und Schamgefühle erzeugen, wenn das Kind glaubt, den hohen Erwartungen gerecht werden zu müssen, und Versagensängste entwickelt.
Genauso wie Strafen kann das Belohnen Forschergeist und Neugier abwürgen, weil das Kind lernt, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Folgt es ohne Einsicht, verliert es seine intrinsische Motivation. Beispiel Zimmer aufräumen: Wird Ordnung gemacht, weil es danach ein Eis oder Handyspielzeit gibt? Oder weil es sich befriedigend und erfüllend anfühlt, am Ende die Sachen so sortiert zu haben, wie man es sich wünscht? Welche Motivation nachhaltiger und im späteren Leben brauchbarer ist, dürfte klar sein.
Wir Eltern laufen zudem Gefahr, die wirklichen Bedürfnisse des Kindes aus dem Blick zu verlieren, wenn es uns nur um die Umsetzung des gewünschten Verhaltens geht:
Warum will das Kind denn noch unbedingt auf dem Spielplatz bleiben? Hat es soeben das Prinzip des rieselnden Sandes entdeckt oder knüpft gerade eine zarte Freundschaft mit
einem Gleichaltrigen? Das werden wir nicht erfahren, wenn wir stur zum Aufbruch drängen. Drohen, Strafen, Erpressen: Bei all diesen Erziehungsmechanismen geht es letztlich um Dominanz und Macht. Werte wie Zusammenarbeit, Harmonie und gegenseitiger Respekt bleiben auf der Strecke.
Aber wie geht es besser? Wie können wir durchsetzen, was uns als Eltern wichtig ist?
Konsequenzen müssen logisch und realisierbar sein
Zunächst sollten wir nur das ankündigen, was auch wirklich umsetzbar ist. Natürlich hängt der Familienurlaub nicht von der Erledigung der Hausaufgaben ab und natürlich gehen wir nicht ohne unser Kind vom Spielplatz nach Hause. Aber vielleicht fällt der Zoobesuch am nächsten Wochenende aus, weil Schularbeiten nachgeholt werden müssen. Oder der kleine Umweg über die tolle rote Brücke ist nicht mehr möglich, weil man sich auf dem Spielplatz vertrödelt hat.
Solche Konsequenzen sind realistisch und zugleich haben sie einen logischen Bezug zum Fehlverhalten. Gut auch, wenn die Konsequenz direkt spürbar ist: Die Kinder haben am Tisch Quatsch gemacht – klar, dass sie das umgestoßene Glas selber aufwischen müssen. Das wirkt nachhaltiger, als wenn Mama ex-plodiert und Papa derweil nörgelnd den Lappen holt. Auch eine Wiedergutmachung ist für größere Kinder einsichtig: Wenn ein Grundschüler das Spielzeug eines anderen mutwillig zerstört hat, ist es legitim, dass er es vom eigenen Taschengeld (zumindest teilweise) ersetzen muss.
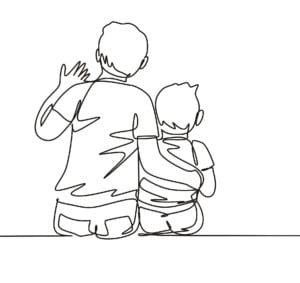 Altersgerecht, klar und in Ich-Botschaften sprechen
Altersgerecht, klar und in Ich-Botschaften sprechen
Auch der alte Ratschlag, in Ich-Botschaften zu sprechen, zeigt Wirkung: „Wir müssen nach Hause und ich will nicht ohne dich vom Spielplatz weggehen“ drückt ebenfalls aus, was jetzt Sache ist – aber auf eine persönliche, zugewandte Art.
Wenn man sich dabei auf das Denken und die Bedürfnisse des Kindes einlässt, stehen die Chancen gut, auf offene Ohren zu treffen.
Deshalb den bevorstehenden Aufbruch rechtzeitig ankündigen und altersgerechte Zeitangaben machen. „Wir können jetzt noch drei Sandkuchen backen und dann packen wir unsere Sachen zusammen.“ Zu Hause schwören viele Familien auf eine Sanduhr, nicht nur beim Zähneputzen: Sie zeigt auch den Kleinen zuverlässig an, wie lange man noch trödeln kann, bevor es aus dem Haus geht, oder wann der Nächste mit Trampolinhüpfen dran ist.
Für gelingende Kommunikation ist es auch wichtig, sich konkret auszudrücken. „Sei brav und benimm dich“ – das sind un-
klare und zudem dehnbare Formulierungen, unter denen sich ein Kind nichts vorstellen kann. „Ich will, dass du den Legoturm deines Bruders in Ruhe lässt“ dagegen macht klar, was erwartet wird. Dann wird es für Kinder auch einsichtig, warum ihr Verhalten so gerade nicht geht. Wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern es grundsätzlich gut mit ihnen meinen, dass sie respektiert und ernst genommen werden, dann „folgen“ sie den Vorgaben durchaus, auch wenn diese ihren momentanen Bedürfnissen zuwiderlaufen. Dann akzeptieren sie, dass die Großen die Situation gerade vielleicht besser überblicken oder in der Familie nun mal Organisations- oder Aufsichtsfunktion haben, sodass jetzt eben nicht alle machen können, was sie wollen.
Gefühle zulassen
Im Idealfall lernen Kinder dann, die Wünsche anderer als genauso wichtig anzusehen wie ihre eigenen – und wenn sich alle aufeinander abstimmen, kann ein konstruktives Zusammenleben gelingen. Das bedeutet zum einen, dass wir Rücksichtnahme von unseren Kindern erwarten dürfen – umgekehrt aber auch, dass wir auf ihre Wünsche und Gefühle eingehen, wenn irgend möglich. Manchmal können wir den Wunsch unseres Kindes nicht berücksichtigen. Aber was wir tun können: seine Enttäuschung, seinen Frust darüber zulassen und anerkennen: „Ja, ich weiß, du bist sauer, weil wir jetzt losgehen. Ich würde dich auch gerne weiterspielen lassen. Aber wir müssen jetzt deine Schwester aus der Kita abholen.“ So lernt das enttäuschte, wütende Kind, dass negative Gefühle nicht verboten sind und es mit all seinen Emotionen akzeptiert wird.
Grenzen respektieren
Der dänische Familientherapeut und bekannte Pädagoge Jesper Juul schreibt (in: „Grenzen, Nähe, Respekt. Auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung“), dass die Grenzen sowohl des Kindes als auch die der Eltern respektiert werden müssen und dass das gegenseitige Kennenlernen dieser Grenzen oft ein Lernprozess ist. Das Anerkennen der Grenzen des Kindes bedeute aber nicht, dass man sich ihnen demütig unterwerfe, so Juul. Umgekehrt sollten auch die Eltern den Mut haben, ihre eigenen Bedürfnisse klar zu artikulieren. Beispiel Schlafengehen: Wenn das Kind nach der Gute-Nacht-Geschichte putzmunter noch eine Spielrunde einfordert, man selber sich aber erschöpft nach der Couch sehnt, schlägt Juul einen Kommentar dieser Art vor: „Ich sehe, du willst noch spielen, aber ich will nicht.“ Jedoch bitte keine Vorwürfe dieser Art: „Siehst du nicht, wie müde ich bin? Kannst du nicht mal Rücksicht nehmen?“ Denn das vermittelt dem Kind nur die Botschaft: Ich bin falsch, weil ich Mamas Wünsche nicht erkenne, und ich darf nicht sagen, was ich gerne möchte.
Gemeinsam Regeln erarbeiten
Knallt es öfters bei ähnlichen Themen, kann man gemeinsam überlegen, wie das passieren konnte und wie es in Zukunft besser laufen könnte. Kinder können sich da schon erstaunlich früh einbringen und für Eltern ist es oft hilfreich, das eigene Verhalten aus deren Perspektive gespiegelt zu bekommen.
So kann man für die Zukunft Familienregeln aufstellen – und zwar gemeinsam. Die Mitwirkung der Kinder darf dabei nicht nur Alibi-Funktion haben. Bei Konflikten ums Essen könnte die Lösung zum Beispiel so aussehen: Es gibt nur das Abendessen, das auf dem Tisch ist. Du darfst aber aussuchen, ob und wieviel du davon isst.
Rituale und Routinen haben übrigens einen ähnlichen Effekt wie verbindliche Familienregeln: Es muss nicht bei jeder Autofahrt neu verhandelt werden, dass es erst losgeht, wenn alle angeschnallt sind. Oder dass abends nach der Gutenachtgeschichte immer das Licht ausgemacht wird.
Erklären statt befehlen
Wir können Grenzen indirekt auch setzen, indem wir für die eigenen Werte eintreten: Bei uns in der Familie wird niemand ausgelacht, wir machen keine Sachen von anderen absichtlich kaputt etcpp. Das halten wir als Eltern selber so – und können dann mit größtem Recht und höchster Glaubwürdigkeit unser Kind darauf hinweisen, wenn es diese Werte missachtet.
Wenn wir Eltern unsere Beweggründe für unsere Skepsis oder Ablehnung erläutern, statt apodiktisch das Gewünschte zu verbieten, fallen unsere Argumente oft auf fruchtbaren Boden – aber nur, wenn unsere Kinder uns als wohlmeinende, verständnisvolle Personen erleben und nicht als Autoritäten, denen es um Gehorsam geht.
Konflikte werden sich so nicht vermeiden lassen – aber wir können sie fair und im Miteinander lösen. Und am Ende steht die Gewissheit: Wir begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung und ziehen als Familie an einem Strang, auch wenn wir nicht einer Meinung sind.
Kleine Ideenkiste: Konflikte entschärfen
+ Prioritäten setzen: Verbote reduzieren, nur wirklich Wichtiges muss reguliert werden.
+ Humor statt harter Worte: Ein Augenzwinkern und positive Stimmung schaffen eine Atmosphäre, in der Lösungen zu finden sind. Auch man selber befreit sich so aus der Schlechte-Laune-Spirale.
+ Die Sache zählt: Auseinandersetzungen, die nur um des Gewinnens willen geführt werden, sind Machtkämpfe ohne Sinn.
+ Energien umlenken und Brücken bauen: den Frust am Sofakissen abreagieren lassen, ein Eimerchen Sand vom Spielplatz mitnehmen, sich alternative Quatsch-Schimpfwörter ausdenken.
+ Den Blick des Kindes einnehmen: „Was ist passiert, dass du später als vereinbart heimkommst?“ So fühlt es sich gesehen und ist eher bereit, Kritik anzunehmen und in Zukunft auf die Sorge der Eltern Rücksicht zu nehmen.
+ Autonomie lassen – zum Beispiel so: Die Verantwortung für pünktliches Losgehen liegt bei den Eltern. Aber ob das trödelnde Kind im Schlafanzug mit zu Oma geht oder rechtzeitig das Sonntagskleidchen anzieht, bleibt ihm überlassen.
+ Aktiv zuhören – fällt manchmal schwer, wirkt aber: Sich mit Belehren, Beraten, Loben und Aufmuntern zurückhalten, sondern durch Aufmerksamkeit und eine offene Haltung dem Kind die Möglichkeit geben, zu einer eigenen Lösung zu gelangen.
+ Keine Grundsatzdebatten in Krisensituationen: Lieber eine ruhige Minute abwarten und beim Spaziergang oder der gemeinsamen Küchenarbeit das Problem ansprechen; eine elterliche 2:1-Übermacht schüchtert ein.
+ Sich mitfreuen, wenn etwas geklappt hat: Die Hausaufgaben sind geschafft – toll! Nicht weil sie endlich abgehakt sind, sondern weil das Kind jetzt etwas Neues kann.